
»Sie hören die Stimme der Hoffnung« - Aus der Arbeit des adventistischen Medienzentrums
Günther Machel ist seit fünf Jahren Geschäftsführer der Stimme der Hoffnung (SDH). Er leitet die Geschicke des - wenn man so will - ältesten deutschen Privatsenders, der seit 1948 christliche Sendungen in deutscher Sprache produziert. Doch nicht nur die adventistische Radioarbeit ist in Darmstadt-Eberstadt beheimatet, sondern auch eine Blindenhörbücherei, ein Cassetten- und Videoversand, ein Bibelstudien-Institut und erste kleine Einrichtungen für einen Fernsehdienst der Kirche. „Rund 20 Personen arbeiten in den verschiedenen Abteilungen hier im Haus”, sagt Günther Machel. Es war ursprünglich ein Wohnhaus und aufgrund der Expansion der Tätigkeiten platzt es heute stellenweise aus den Nähten.
Von zentraler Bedeutung ist natürlich der Hörfunk. Günther Machel erzählt von den Anfängen der Arbeit, als nach dem zweiten Weltkrieg deutschsprachige Sendungen als Ableger des US-amerikanischen Radiomissionswerkes „Voice of Prophecy” gegründet wurden. Sendezeit wurde bei Radio Luxemburg angemietet. Der damalige Sprecher, Max Busch, musste zur Aufnahme der Sendungen nach Paris fahren, da hierzulande kein Studio zur Verfügung stand.
 Drei
Männer, die die ersten sechszehn Jahre der Stimme der Hoffnung
prägten: Max Busch (zweiter von rechts), Erwin Berner (dritter von
rechts) und Oswald Bremer (links).
Drei
Männer, die die ersten sechszehn Jahre der Stimme der Hoffnung
prägten: Max Busch (zweiter von rechts), Erwin Berner (dritter von
rechts) und Oswald Bremer (links).
Anfang der siebziger Jahre entdeckten die Adventisten die Kurzwelle für sich: Sines in Portugal, Andorra, Italien, Russland und die Slowakei waren die Staaten, von denen aus Adventist World Radio (AWR), der weltweit tätige Radiozweig der Kirche, und die Stimme der Hoffnung als nationaler Partner ihre Programme abstrahlten.
Die Stimme der Hoffnung ist ein eingetragener Verein, der von der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, so die genaue Bezeichnung der Kirche, getragen wird. Die Organisationsstruktur der Gemeinschaft fasst mehrere Ortsgemeinden zu „Vereinigungen” zusammen, diese wiederum zu „Verbänden”, von denen es in Deutschland zwei gibt: einen Verband für Süddeutschland und einen für Norddeutschland. Alle Verbände in Europa sind in Kontinentalen Arbeitsgemeinschaften, 'Divisionen' genannt, zusammengeschlossen. Das Darmstädter Medienzentrum ist nun direkt der Division für Mittel, Süd und Osteuropa mit Sitz in Bern verantwortlich, da es für den gesamten deutschsprachigen Raum zuständig ist. Für die Arbeit steht ein Jahresbudget von ein bis zwei Millionen Euro zur Verfügung, die weitgehend durch freiwillige Spenden und der einmal im Jahr stattfindenden Kollekte am „Tag der Stimme der Hoffnung” erwirtschaftet werden.
 Redakteur
Hartmut Wolf bei der Produktion einer Sendung.
Redakteur
Hartmut Wolf bei der Produktion einer Sendung.
Die Dachorganisation der adventistischen Radioarbeit ist Adventist World Radio (AWR); dessen europäische Zentrale befindet sich in London. AWR ist für die Abwicklung aller internationaler Radioausstrahlungen zuständig und verhandelt mit den jeweiligen Sendebetreibern. Für die Programminhalte der Kurzwellen- und Satellitensendungen ist ein dreiköpfiges Team verantwortlich. Es besteht [1998] aus Werner Renz, Hartmut Wolf und Friedemann Mahlhus. Letzterer war vor seinem Dienst in Darmstadt lange Jahre Leiter der „Friedensauer Bild- und Tonstelle”, in der die Medienarbeit der Gemeinschaft in der DDR getan wurde. Die Redakteure erstellen eine halbe Sendestunde am Tag. Zielgruppe der Sendungen und deren Inhalte seien nicht in erster Linie die Adventisten. Günther Machel dazu: „Die Stimme der Hoffnung will auf den Markt, wir wollen, dass möglichst jeder uns hört.” Dabei verstehe man sich nicht als dezidiert adventistischer, sondern als christlicher Programmanbieter. In der Gesellschaft habe das Wissen um die gemeinsame christliche Lehre stark abgenommen. Deshalb sollen die Programme so gestaltet sein, dass sie sich an die nicht-christlichen Hörer richten. Ihnen will man christliche Sichtweisen zu den Problemen unserer Zeit vermitteln, ihnen Ratschäge zur Erhaltung der Gesundheit geben und vieles mehr. Auch gehe es nicht um die Lehrmeinungen, die die Adventisten von den Volkskirchen und den anderen Freikirchen unterscheidet, wie zum Beispiel die Heiligung des Sabbats, also des Samstages. „Was soll ein Arbeitsloser, für den jeder Tag ein 'Ruhetag' ist, von einer Sendung zu diesem Thema halten?” bringt es Geschäftsführer Machel auf den Punkt.
 Mit
einem rollenden Video, Kassetten und CD-Shop ist Ralf Brunotte
Mit
einem rollenden Video, Kassetten und CD-Shop ist Ralf Brunotte
auf Veranstaltungen anzutreffen.
Auf seinem Schreibtisch findet Werner Renz heute zwei Briefe, die auf eine seiner Sendungen eingegangen sind. Etwa 20 Prozent seiner Arbeit, so schätzt er, besteht aus der „Nachbearbeitung” der Radioprogramme, also aus der Hörer-Korrespondenz, letztendlich aus individueller Seelsorge. In den Zuschriften geht es oftmals „um's Eingemachte”, um sehr private Probleme der Hörer, um Fragen nach Partnerschaft und Sexualität etwa, die es zu beantworten gilt.
Ein anderes Redaktionsteam ist für die SDH-Sendungen auf UKW zuständig. Mit dem „Medienpolitischen Urknall” im Jahre 1984 erweiterten die Adventisten ihr Betätigungsfeld in Richtung der „neuen”, privaten Medien. So war man als Anbieter auf einem der Kabel-Hörfunkkanäle des Pilotprojekts Ludwigshafen mit von der Partie. Im Laufe der Zeit gründeten sich in verschiedenen Bundesländern Radioteams und Initiativgruppen, die vor Ort die adventistische Radioarbeit aufbauten. Heute sind es rund 20 Gruppen, die allesamt unabhängig sind, jedoch von Darmstadt aus unterstützt werden. Somit können beispielsweise Hörer in verschiedenen Städten Nordrhein-Westfalens adventistische Programme im Bürgerfunk hören, in anderen Regionen nutzt man die Möglichkeiten, die die Offenen Kanäle oder der Nichtkommerzielle Lokalfunk bietet, in Nürnberg hat man ein eingenständiges sonntägliches Magazin namens „Pray 92,9” auf UKW. Außerdem beliefert die Darmstädter Zentrale das christliche Radio Paradiso in Berlin mit Beiträgen und Programmblöcken. Weitere UKW-Programme laufen auch in Österreich, Frankreich und Italien.
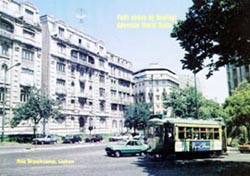 Die klassische Arbeit auf Kurzwelle erfuhr im Jahr 1997 eine
einschneidende Veränderung. Die Stimme der Hoffnung und Adventist
World Radio beschlossen, die KW-Ausstrahlungen über den
leistungsstarken Sender in der Slowakei einzustellen. Übrig blieb
nur der kleine AWR-eigene Sender im norditalienischen Forlí, dessen
Empfang hierzulande in der Regel eher mäßig war. Hintergründe für
die Entscheidung waren die gestiegenen Preise für den slowakischen
Sender und die Aussichten, in Argenta (Italien) eine eigene,
leistungsstarke Station errichten zu können. Während letzteres
Vorhaben erst in etwa zwei Jahren hätte verwirklicht werden können,
beschloss man Europa über Satellit zu erreichen. Hierfür bot sich
die Beteiligung am Programmbouquet von World Radio Network (WRN) in
London an. Im Januar 1998 startete dieser Dienst, und seither waren
zwei Halbstundenprogramme auf WRN Deutsch und zwei weitere in
Englisch auf WRN 1 zu hören. Hinzu kam die Möglichkeit, via WRN im
RealAudio-Verfahren auf der internationalen Datenautobahn präsent zu
sein. Letzteres mit positiven Rückmeldungen: Günter Machel
berichtete von Hörern aus Nordamerika und Australien, die sich schon
für die gehörten Internet-Programme bedankt haben.
Die klassische Arbeit auf Kurzwelle erfuhr im Jahr 1997 eine
einschneidende Veränderung. Die Stimme der Hoffnung und Adventist
World Radio beschlossen, die KW-Ausstrahlungen über den
leistungsstarken Sender in der Slowakei einzustellen. Übrig blieb
nur der kleine AWR-eigene Sender im norditalienischen Forlí, dessen
Empfang hierzulande in der Regel eher mäßig war. Hintergründe für
die Entscheidung waren die gestiegenen Preise für den slowakischen
Sender und die Aussichten, in Argenta (Italien) eine eigene,
leistungsstarke Station errichten zu können. Während letzteres
Vorhaben erst in etwa zwei Jahren hätte verwirklicht werden können,
beschloss man Europa über Satellit zu erreichen. Hierfür bot sich
die Beteiligung am Programmbouquet von World Radio Network (WRN) in
London an. Im Januar 1998 startete dieser Dienst, und seither waren
zwei Halbstundenprogramme auf WRN Deutsch und zwei weitere in
Englisch auf WRN 1 zu hören. Hinzu kam die Möglichkeit, via WRN im
RealAudio-Verfahren auf der internationalen Datenautobahn präsent zu
sein. Letzteres mit positiven Rückmeldungen: Günter Machel
berichtete von Hörern aus Nordamerika und Australien, die sich schon
für die gehörten Internet-Programme bedankt haben.
Im Zusammenhang mit der Kurzwelle gehen die Verantwortlichen in Darmstadt von einer Nische mit nicht mehr steigerbaren, gleichwohl aber festen Hörerzahlen aus. Natürlich habe die Reduzierung der KW-Sendungen auch negative Reaktionen seitens mancher DXer und KW-Hörer hervorgerufen. Diese Hörergruppe nimmt man sehr wohl ernst - so hält der SDH-Mitarbeiter Lothar Klepp die interessante Broschüre „Kurzwelle - nicht nur für DXer” bereit und beantwortet gerne Fragen zur Empfangstechnik.
 Erste Schritte zum Aufbau eines
eigenen Fernsehdienstes wurden in Darmstadt am 6. Juni 1998 gemacht.
An diesem Festtag zum 50-jährigen Jubiläum wurden der Gottesdienst
und die nachmittägliche Feierstunde über den Satelliten „Intelsat K”
an adventistische Gemeinden im gesamten deutschsprachigen Europa
übertragen. Die Reaktionen seien durchweg positiv gewesen. „Wir
haben die Anforderungen technisch und gestalterisch gut lösen
können”, sagt Geschäftsführer Günther Machel.
Erste Schritte zum Aufbau eines
eigenen Fernsehdienstes wurden in Darmstadt am 6. Juni 1998 gemacht.
An diesem Festtag zum 50-jährigen Jubiläum wurden der Gottesdienst
und die nachmittägliche Feierstunde über den Satelliten „Intelsat K”
an adventistische Gemeinden im gesamten deutschsprachigen Europa
übertragen. Die Reaktionen seien durchweg positiv gewesen. „Wir
haben die Anforderungen technisch und gestalterisch gut lösen
können”, sagt Geschäftsführer Günther Machel.
Beim Rundgang führt er die Videoschnittplätze vor; Kameras werden derweil von einigen Mitarbeitern auf ihre Tauglichkeit getestet. Ähnlich wie bei der Satellitenevangelisation „Pro Christ” will man zukünfitg weitere TV-Ausstrahlungen für einen geschlossenen Nutzerkeis durchführen. „Natürlich wollen wir die Radioarbeit, die wir seit 50 Jahren betreiben, auf keinen Fall aufgeben oder auch nur vernachlässigen.” Mit diesem Bekenntnis zum Radio ist die Einladung zum Hören der Sendungen verbunden.
Kleine Chronik 1948 bis 1998
|
 Mit einer Festveranstaltung beging die
adventistische STIMME DER HOFFNUNG in Darmstadt am 6. Juni 1998 ihr
50-jähriges Bestehen. Erstmals schloss man für diese Veranstaltung
150 Gemeinden über Satellitenfernsehen an das Geschehen an.
Mit einer Festveranstaltung beging die
adventistische STIMME DER HOFFNUNG in Darmstadt am 6. Juni 1998 ihr
50-jähriges Bestehen. Erstmals schloss man für diese Veranstaltung
150 Gemeinden über Satellitenfernsehen an das Geschehen an.
Thomas Völkner
Fotos: © Thomas Völkner; Stimme der Hoffnung
www.stimme-der-hoffnung.de
Aus RADIOJournal 9/1998
 • Die
deutschsprachige Halbstunden-Sendung kommt nicht mehr über World
Radio Network (WRN). Aus Kostengründen wurde die
Kurzwellenabstrahlung des deutschsprachigen Programms Ende März 2007
eingestellt. Stattdessen wurde das 24-stündige Radioprogramm von
HOPE-Channel über Satellit und Internet ausgebaut.
Programminformationen sind auf der Hope Channel-Webseite abrufbar.
Hier gibt es auch einen Audio- und Videostream der Hörfunk- und
TV-Sendungen:
www.hopechannel.de
• Die
deutschsprachige Halbstunden-Sendung kommt nicht mehr über World
Radio Network (WRN). Aus Kostengründen wurde die
Kurzwellenabstrahlung des deutschsprachigen Programms Ende März 2007
eingestellt. Stattdessen wurde das 24-stündige Radioprogramm von
HOPE-Channel über Satellit und Internet ausgebaut.
Programminformationen sind auf der Hope Channel-Webseite abrufbar.
Hier gibt es auch einen Audio- und Videostream der Hörfunk- und
TV-Sendungen:
www.hopechannel.de
• Ein neues Medienzentrum in Alsbach-Hähnlein (Landkreis Darmstadt-Dieburg) wurde am 3. März 2007 eingeweiht.
